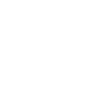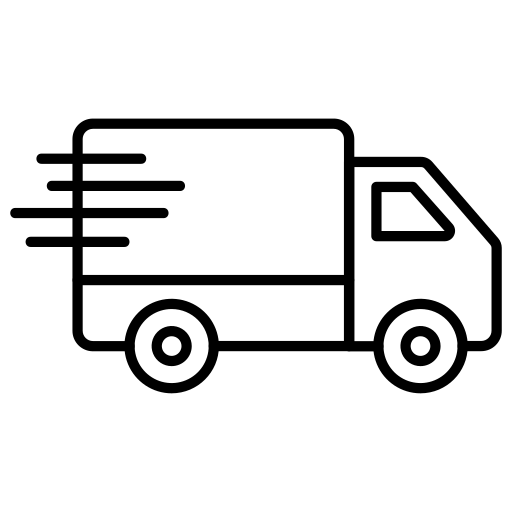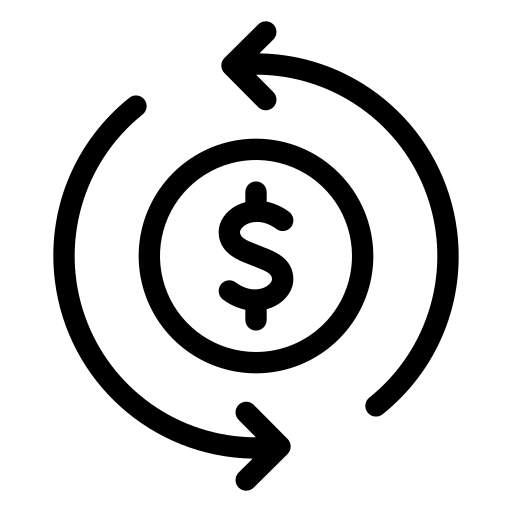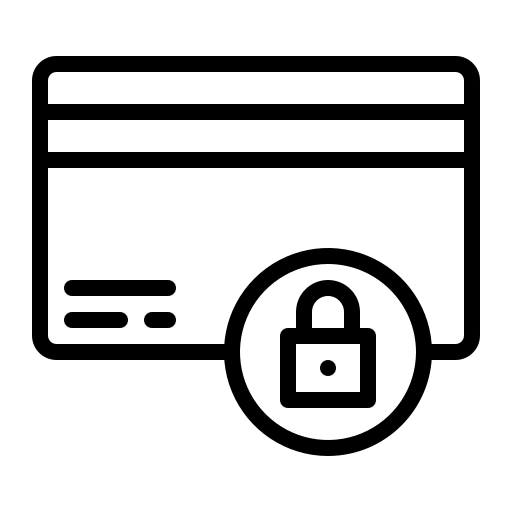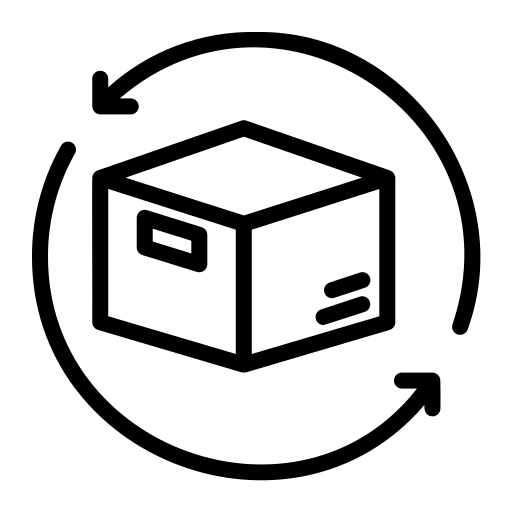Viele Frauen erleben nach der Geburt ihres Kindes zum ersten Mal Probleme mit der Blasenkontrolle. Unfreiwilliger Urinverlust – medizinisch Harninkontinenz oder umgangssprachlich Blasenschwäche genannt – ist kein seltenes Phänomen im Wochenbett. Schätzungen zufolge hat etwa jede vierte Frau nach einer vaginalen Entbindung Schwierigkeiten, den Urin zu halten. Wichtig ist: Sie sind damit nicht allein, und die Situation muss nicht dauerhaft Ihr „neuer Alltag“ bleiben.
In diesem Artikel erklären wir einfühlsam und fundiert, was Inkontinenz nach der Geburt bedeutet, welche Ursachen und Formen dahinterstecken und welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt. Außerdem geben wir praxisnahe Tipps für den Alltag und zeigen Wege auf, mit der psychischen Belastung umzugehen.
Was bedeutet Inkontinenz nach der Geburt?
Unter postpartaler Inkontinenz versteht man den unwillkürlichen Verlust von Urin in der Zeit nach der Entbindung. Typischerweise bemerken betroffene Frauen, dass beim Husten, Niesen, Lachen oder Heben plötzlich ein paar Tropfen Urin entweichen können. Auch ein plötzlich stark auftretender Harndrang kann vorkommen, bei dem man es nicht rechtzeitig zur Toilette schafft. Viele frischgebackene Mütter sind überrascht oder verunsichert von diesen Symptomen, zumal Inkontinenz häufig als Altersproblem betrachtet wird. Doch Harninkontinenz nach der Geburt ist weit verbreitet und in den allermeisten Fällen vorübergehend. Sie resultiert direkt aus den körperlichen Veränderungen durch Schwangerschaft und Geburt. Wichtig zu wissen: Es handelt sich nicht um Ihre „Schuld“, sondern um eine körperliche Folge der Geburt, die mit Zeit und Training meist gut in den Griff zu bekommen ist. Sprechen Sie ohne Scheu Ihre Hebamme oder Gynäkologin darauf an – Inkontinenz nach der Geburt ist ein sehr häufiges Problem und lässt sich in den meisten Fällen erfolgreich behandeln.
Ursachen und Risikofaktoren
Die Hauptursache für Inkontinenz im Wochenbett ist eine Schwächung des Beckenbodens. Die Beckenbodenmuskulatur bildet die muskuläre Grundlage des Rumpfes und stützt Blase, Gebärmutter und Darm. Schwangerschaft und Geburt stellen eine enorme Belastung für diese Strukturen dar: Die Muskulatur und das Bindegewebe werden stark gedehnt und beansprucht, damit das Kind geboren werden kann. Dadurch kann der Beckenboden vorübergehend an Spannkraft verlieren und die Harnröhre nicht mehr fest genug verschließen – es kommt zu unkontrolliertem Urinabgang.

Ob und wie stark eine Frau nach der Geburt unter Inkontinenz leidet, hängt von verschiedenen Risikofaktoren ab. Studien und Experten nennen unter anderem folgende Faktoren, die mit einem erhöhten Inkontinenzrisiko nach der Geburt einhergehen:
- Lange Geburtsdauer bzw. Austreibungsphase: Wenn die Presswehen sehr lange dauern, wird der Beckenboden über einen längeren Zeitraum extrem belastet.
- Hohes Geburtsgewicht des Kindes: Ein sehr schweres Baby kann bereits in der Spätschwangerschaft und bei der Geburt den Beckenboden besonders stark fordern.
- Höheres Alter der Mutter: Ältere Mütter haben ein etwas erhöhtes Risiko für eine Beckenbodenschwäche nach der Entbindung.
- Übergewicht und starke Gewichtszunahme: Überflüssige Kilos vor oder während der Schwangerschaft erhöhen den Druck auf den Beckenboden und begünstigen Inkontinenz.
- Bereits bestehende Blasenschwäche in der Schwangerschaft: Frauen, die schon während der Schwangerschaft gelegentlich Urin verloren haben, sind nach der Geburt häufiger betroffen.
- Geburtsverletzungen oder operative Entbindungen: Verletzungen (z. B. Dammriss/-schnitt) oder instrumentelle Entbindungen mit Zange oder Saugglocke können den Beckenboden zusätzlich schwächen.
All diese Faktoren können – müssen aber nicht – dazu führen, dass Sie nach der Geburt vorübergehend an einer Blasenschwäche leiden. Wichtig ist zu betonen, dass jede Geburt eine enorme körperliche Leistung ist und selbst ohne besondere Risikofaktoren der Beckenboden Zeit zur Erholung braucht. In den ersten Tagen und Wochen nach der Entbindung sind viele Frauen von leichter Inkontinenz betroffen. Gönnen Sie Ihrem Körper also Geduld, und scheuen Sie sich nicht, Hilfe anzunehmen.
Formen der Inkontinenz nach der Geburt
Mediziner unterscheiden mehrere Formen der Harninkontinenz, von denen nach Geburten vor allem zwei Typen relevant sind:
- Belastungsinkontinenz: Diese Form tritt am häufigsten nach Geburten auf. Der Verschlussmechanismus der Harnröhre ist geschwächt, sodass bei körperlicher Belastung oder Druckerhöhung im Bauchraum unwillkürlich Urin abgeht. Typische Situationen sind Husten, Niesen, Lachen oder Sport – dabei kommt es zu einem plötzlichen Druckanstieg, dem die geschwächte Beckenbodenmuskulatur nicht standhalten kann.
- Dranginkontinenz: Hierbei steht ein überfallartiger Harndrang im Vordergrund, obwohl die Blase noch nicht vollständig gefüllt ist. Die Blasenmuskulatur reagiert überaktiv und zieht sich plötzlich zusammen. Betroffene verspüren eine plötzliche, starke Toiletten-Eile und verlieren dabei unter Umständen Urin, wenn sie es nicht rechtzeitig schaffen.
Gut zu wissen: Wenn Sie nach der Geburt von Inkontinenz betroffen sind, handelt es sich in den meisten Fällen um die Belastungsinkontinenz. Das heißt, der Fokus der Behandlung liegt vor allem darauf, den Beckenboden zu stärken und den urethralen Verschlussmechanismus wieder zu verbessern.
Behandlung: Was hilft gegen Inkontinenz nach der Geburt?
Die gute Nachricht lautet: Inkontinenz nach der Geburt ist in den meisten Fällen gut behandelbar. Viele Frauen bemerken innerhalb der ersten 6 bis 12 Monate nach der Entbindung eine deutliche Besserung der Symptome. Voraussetzung ist meist, dass man aktiv etwas dafür tut – allen voran den Beckenboden zu trainieren. Die moderne Frauenheilkunde empfiehlt einen stufenweisen Therapieverlauf: Zunächst werden konservative Maßnahmen ausgeschöpft, erst wenn diese nicht ausreichen, denkt man über medikamentöse oder operative Optionen nach. Ihre Gynäkologe*in wird gemeinsam mit Ihnen einen passenden Behandlungsplan erstellen.
Beckenbodentraining und Rückbildung
Bei einer Belastungsinkontinenz steht an erster Stelle die Kräftigung der Beckenbodenmuskulatur. Nach der Geburt haben Sie in der Regel Anspruch auf Rückbildungsgymnastik – dieser Kurs (heute oft auch online angeboten) fokussiert sich darauf, die während Schwangerschaft und Geburt beanspruchten Muskeln wieder zu straffen. In einem solchen Kurs oder bei einer spezialisierten Physiotherapeutin lernen Sie gezielte Beckenbodenübungen, auch bekannt als Kegel-Übungen.
Wichtig ist: Nicht zu früh und nicht zu spät mit dem Training beginnen. Sobald Ihr Körper bereit ist, sollten Sie aktiv werden, um die Muskulatur rechtzeitig zu stärken – aber eben unter Anleitung und ohne Überlastung direkt nach der Geburt.
Pessar und weitere Hilfsmittel
Falls vorübergehend konservative Maßnahmen nicht ausreichen oder bestimmte Befunde vorliegen (z. B. eine leichte Senkung der Blase oder Gebärmutter), kann eine Pessartherapie sinnvoll sein. Ein Pessar ist ein kleines ringförmiges oder würfelförmiges Silikon-Hilfsmittel, das in die Scheide eingeführt wird und dort mechanisch die Harnröhre sowie Organe stützt.
Medikamentöse und operative Optionen
In den meisten Fällen stehen Übungen und Hilfsmittel im Vordergrund. Falls jedoch eine ausgeprägte Inkontinenz vorliegt oder konservative Therapien nicht den gewünschten Erfolg bringen, gibt es weitere Möglichkeiten.
Psychische Belastung: Sie sind nicht allein
Neben den körperlichen Aspekten bringt Inkontinenz nach der Geburt oft auch emotionale Herausforderungen mit sich. Gerade in einer Lebensphase, in der sich ohnehin vieles verändert – Ihr Körper erholt sich von Schwangerschaft und Geburt, die Hormone stellen sich um, und Sie navigieren das Leben mit einem Neugeborenen – kann eine Blasenschwäche zusätzlicher Stress sein. Viele Frauen fühlen sich zunächst beschämt, verunsichert oder frustriert, wenn sie den Urin nicht wie gewohnt kontrollieren können. Wichtig ist hier: Machen Sie sich klar, dass Sie nicht alleine sind und dass mit Ihnen nichts „falsch“ ist.
Perspektive: Wie geht es weiter?
Die gute Nachricht zum Schluss: Inkontinenz nach der Geburt ist in den meisten Fällen vorübergehend. Mit fortschreitender Rückbildung und etwas Training gewinnen die allermeisten Frauen ihre Blasenkontrolle nach einigen Wochen bis Monaten zurück. Viele verspüren bereits innerhalb von drei Monaten deutliche Verbesserungen; nach 6–12 Monaten sind die Symptome bei den meisten Betroffenen nahezu verschwunden.
Bleiben Sie dran und seien Sie gut zu sich selbst! Sie haben es verdient.
Hinweis: Einige der in diesem Beitrag genannten Produkte stammen aus unserem eigenen Sortiment. Wir empfehlen sie, weil wir von ihrer Qualität überzeugt sind. Viel Spaß beim Stöbern!

Philipp Schlosser ist bei Harmony Care als Redakteur aktiv und spezialisiert sich auf Gesundheitsthemen. Mit seiner langjährigen Erfahrung in der Kundenkommunikation und seinem fundierten Wissen über Inkontinenzprodukte sorgt er für fachkundige und praxisnahe Inhalte.
Transparenzhinweis: Dieser Beitrag enthält Werbung für unsere eigenen Produkte. Wir stellen Ihnen nützliche Informationen zur Verfügung und empfehlen dabei Artikel aus unserem Sortiment.