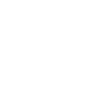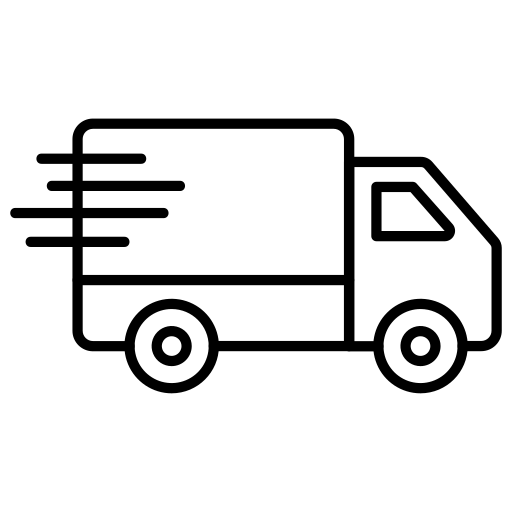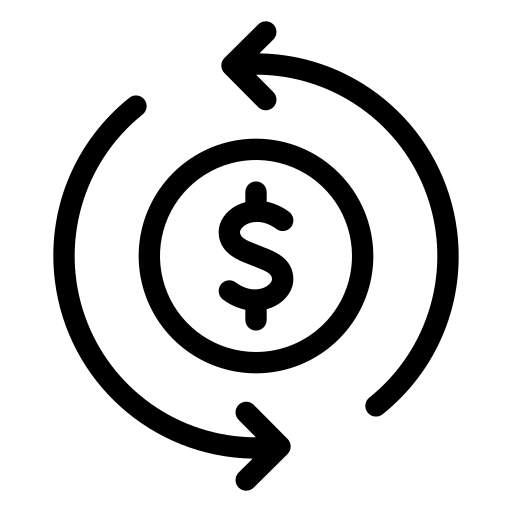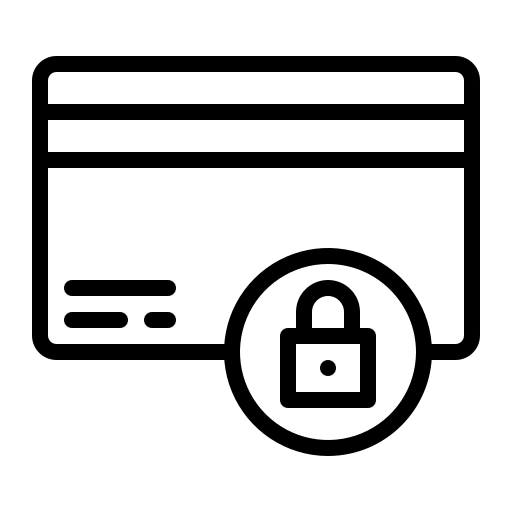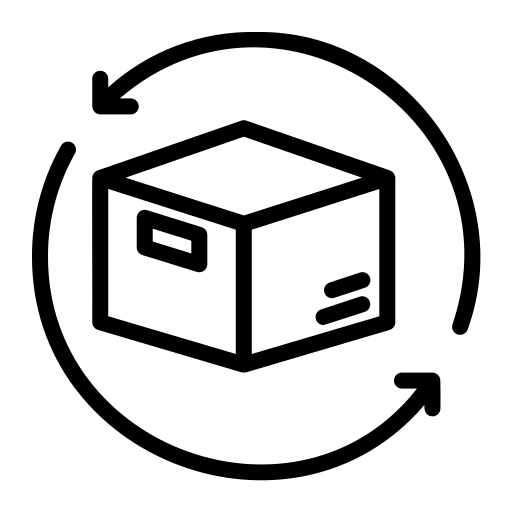Inkontinenz (Blasenschwäche oder Darminkontinenz) kann den Alltag stark beeinträchtigen.
In Deutschland leiden Millionen Menschen unter Harninkontinenz – vor allem mit zunehmendem Alter und bei Frauen etwa durch Schwangerschaft oder Wechseljahre. Auch Stuhlinkontinenz kommt vor, etwa nach bestimmten Erkrankungen oder Operationen.

Ob und welchen Grad der Behinderung (GdB) man dafür erhält, hängt von der individuellen Schwere und den daraus resultierenden Einschränkungen ab. In jedem Fall kann man unabhängig von anderen Erkrankungen beim Versorgungsamt einen Antrag stellen.
Ab einem GdB von 50 gilt man als schwerbehindert und erhält besondere Schutzrechte.
Was ist der Grad der Behinderung (GdB)?
Der GdB ist eine gesetzliche Kennzahl (20 bis 100 in Zehnerschritten), die ausdrückt, wie stark jemand durch eine Behinderung in der Teilhabe am gesellschaftlichen Lebeneingeschränkt ist.

Je höher der Wert, desto größer die Einschränkung. Ein GdB unter 50 bringt bereits steuerliche Entlastungen (Behinderten-Pauschbetrag) oder besonderen Kündigungsschutz ab GdB 30.
Ab GdB 50 gilt man als schwerbehindert (Behindertenausweis möglich). Dieser Status eröffnet weitere Nachteilsausgleiche (z.B. mehr Urlaubstage, früherer Renteneintritt, Fahrtkostenpauschale).
Inkontinenz als Behinderungsgrund
Harn- oder Stuhlinkontinenz können einzeln einen GdB rechtfertigen, wenn sie das tägliche Leben erheblich einschränken.
Laut Versorgungsmedizinischen Grundsätzen (offizielle Bewertungskriterien) dienen die Symptome als Maßstab. Beispielsweise zählt allein durch Inkontinenz hoher Flüssigkeitsverlust, ständiges Wickeln oder soziale Isolation zu erheblichen Beschwerden.
Der Gesetzgeber fordert in diesem Fall im Prüfgutachten genaue Angaben zum Inkontinenzbild, damit der GdB korrekt ermittelt wird.
GdB-Einstufung bei Harninkontinenz
Die offizielle VersMedV-Einstufung unterscheidet verschiedene Schweregrade der Harninkontinenz. Typische Einstufungen sind etwa:
● GdB 0–10: Leichter Harnverlust nur bei starker Belastung (z.B. Stressinkontinenz Grad I).
● GdB 20–40: Häufiger Harnverlust tags und nachts (z.B. Stressinkontinenz Grad II–III).
● GdB 50: Vollständige (totale) Inkontinenz, wenn Betroffene die Blasenentleerung gar nicht mehr kontrollieren können.
● GdB 60–70: Bei kompletter Inkontinenz mit ungünstiger Versorgungsmöglichkeit (z.B. wenn keine passenden Hilfsmittel zur Verfügung stehen) kann sich der GdB erhöhen.
Diese Einordnung bedeutet etwa: Wer nur gelegentlich beim Niesen oder Lachen ein paar Tropfen verliert, kann im günstigsten Fall einen GdB um 10 erhalten.
Dagegen führt dauernder, unkontrollierter Urinverlust zu GdB 50 oder mehr.
Wichtig ist: Ein ärztlicher Bericht sollte klar schildern, in welchen Situationen und wie oft der Harnverlust auftritt. Beschreibt Ihr Arzt nur pauschal „Inkontinenz“, genügt das meist nicht. Ein detailliertes Gutachten (z.B. Tagesprotokoll, Inkontinenztagebuch) hilft dem Versorgungsamt, den GdB fair einzuschätzen.
GdB-Einstufung bei Stuhlinkontinenz
Für Stuhlinkontinenz gelten ähnliche Kriterien. Danach kann z. B. gelten:
● GdB 10: Seltene, kaum spürbare unwillkürliche Stuhlabgänge unter besonderer Belastung.
● GdB 20–40: Häufigerer, regelmäßiger unwillkürlicher Stuhlabgang (z.B. bei alltäglichen Verrichtungen).
● GdB 50: Vollständiger Funktionsverlust des Afterschließmuskels (continenter Stuhlverlust).
Das bedeutet: Je mehr und häufiger unkontrolliert Stuhl auftritt, desto höher der GdB.
Auch hier zählt die subjektive Belastung: Wer zum Beispiel ständig Windeln tragen oder die eigene Ernährung stark umstellen muss, bekommt eher einen höheren GdB.
Antragstellung und ärztliches Gutachten
Um einen GdB feststellen zu lassen, muss man einen schriftlichen Antrag beim zuständigen Versorgungsamt stellen.
Dabei hilft ein ausführliches ärztliches Gutachten: Bitten Sie Ihre behandelnden Ärzte (z.B. Hausarzt, Urologe) um eine genaue Schilderung Ihrer Inkontinenzsymptome.
Wichtige Angaben sind, in welchen Alltagssituationen (Husten, Sport, Nachtschlaf, Toilettengänge) es zu Verlusten kommt und wie oft.

● Unterlagen sammeln: Tagebuch führen, Berichte über Inkontinenzvorfälle notieren. Benennen Sie konkrete Beispiele (z.B. „Trittfelddruck beim Gehen“).
● Ärztlichen Bericht einholen: Bitten Sie Ihren Arzt um ein detailliertes Attest, das Ihre Symptome, Therapien und Einschränkungen beschreibt. So zeigt der Gutachter, wie stark Ihre Lebensqualität leidet.
● Antrag beim Versorgungsamt: Sie erhalten dort meist ein Formular oder können online einen Antrag auf Feststellung des GdB stellen. Reichen Sie alle Befunde, Berichte und Atteste gleich mit ein.
● Gutachten und Entscheidung: Das Versorgungsamt beauftragt einen ärztlichen Gutachter. Dieser wertet Ihre Unterlagen aus und kann Sie auch persönlich untersuchen. Wichtig: Sie sollten Ihre Ärzte von der Schweigepflicht entbinden, damit der Gutachter direkt Befunde erfragen darf.
● Feststellungsbescheid: Nach Prüfung erhalten Sie einen schriftlichen Bescheid mit GdB und ggf. Merkzeichen. Wenn Sie mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind, können Sie innerhalb eines Monats Widerspruch einlegen. In der Regel gibt das Verfahren einige Monate Zeit (Antrag, Bearbeitung, Bescheid).
Fallbeispiel
Frau Meier, 68, hat seit einigen Jahren eine Belastungsinkontinenz. Nach dem Toilettengang verliert sie häufig ein paar Tropfen Urin, besonders beim Tragen von Einkäufen. Sie berichtet zudem über nächtliche Verluste. Ihr Hausarzt beschreibt in einem Bericht, dass trotz Behandlungen regelmäßige Inkontinenz auftritt und sie deshalb ständig saugfähige Einlagen tragen muss.
Aufgrund dieser Angaben stellte Frau Meier einen GdB-Antrag.
Das Versorgungsamt bestätigte ihre Angaben durch einen ärztlichen Gutachter und erkannte ihr GdB 30 zu (mittlere Inkontinenz).
Dies bedeutet für sie u.a. einen Behinderten-Pauschbetrag in der Steuererklärung.
Welche Vorteile bringt ein GdB?
Ein GdB allein aufgrund von Inkontinenz kann je nach Höhe Entlastungen bringen. Schon ab GdB 20 oder 30 sind steuerliche Nachteilsausgleiche möglich (Behinderten-Pauschbetrag, evtl. besonderer Kündigungsschutz). Erreicht der GdB 50, gelten Sie als schwerbehindert. Das eröffnet weitere Vergünstigungen: z.B. höhere Steuerfreibeträge, mehr Urlaubstage, früherer Renteneintritt oder Hilfe im Beruf (leichterer Zugang zu Arbeitsassistenz). Zudem können pflegende Angehörige wissen, dass bei einem GdB Pflegehilfe leichter erreichbar ist.

Wichtig ist: Der GdB bemisst sich nicht nach Diagnosen, sondern nach Auswirkungen im Alltag. Selbst mit der gleichen Inkontinenz-Diagnose kann der GdB individuell unterschiedlich ausfallen, je nachdem, wie stark das Leben eingeschränkt ist. Deshalb lohnt sich eine sorgfältige Dokumentation und gegebenenfalls Unterstützung durch Beratungsstellen (z.B. Sozialverband VdK, Rehadat-Infoportal) bei der Antragstellung.
Hinweis: Einige der in diesem Beitrag genannten Produkte stammen aus unserem eigenen Sortiment. Wir empfehlen sie, weil wir von ihrer Qualität überzeugt sind. Viel Spaß beim Stöbern!

Philipp Schlosser ist bei Harmony Care als Redakteur aktiv und spezialisiert sich auf Gesundheitsthemen. Mit seiner langjährigen Erfahrung in der Kundenkommunikation und seinem fundierten Wissen über Inkontinenzprodukte sorgt er für fachkundige und praxisnahe Inhalte.
Transparenzhinweis: Dieser Beitrag enthält Werbung für unsere eigenen Produkte. Wir stellen Ihnen nützliche Informationen zur Verfügung und empfehlen dabei Artikel aus unserem Sortiment.